Die energetischen Vier
Die Superhelden der Energiewende
Der massive Ausbau der Versorgung mit regenerativer Energie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Energiewende gelingt. Aktuell liegt der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bei über 40 Prozent – verglichen mit sechs Prozent im Jahr 2000 ein großer Erfolg, mit Blick auf Klimaneutralität in 24 Jahren jedoch eine gewaltige Herausforderung.
Es ist vor allem auch eine Herausforderung an die universitäre Forschung, diesen Prozess zu unterstützen. Die FAU besitzt auf diesem Gebiet eine besonders beeindruckende Expertise: Materialwissenschaften, Verfahrenstechnik, Leistungselektronik oder Geologie sind bundesweit, zum Teil weltweit führend bei der Entwicklung neuer Materialien und Technologien sowie der Erschließung neuer Quellen nachhaltiger Energie.
Dabei geht es nicht allein um höhere Wirkungsgrade, intelligentere Steuerung oder neue Infrastrukturen, sondern auch darum, Produkte und Verfahrensprozesse umweltverträglicher zu gestalten – wie die Beispiele organischer Solarmodule oder Biokatalysatoren zeigen.
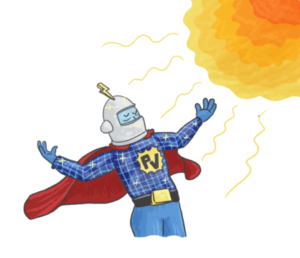
(Illustration: Roland Hallmeier)
Solarenergie: Strom aus transparenten Folien
Aktuell deckt die Fotovoltaik knapp zehn Prozent des deutschen Strombedarfs. In den kommenden Jahrzehnten soll ihr Anteil jedoch auf 50 Prozent des Gesamtenergiebedarfs steigen – eine wahre Herkulesaufgabe.
Um diesen Ausbau nachhaltig und ressourcenschonend zu gestalten, wird intensiv an Alternativen zur Siliziumtechnologie geforscht. „Wir brauchen neue Technologien für den Ausbau der Fotovoltaik jenseits der verfügbaren Konversionsflächen für Solarparks oder Dachflächen auf Gebäuden“, sagt Prof. Dr. Christoph J. Brabec vom Department Werkstoffwissenschaften. „Der Einsatz von flexiblen und transparenten Solartechnologien, die in beliebige Oberflächen integriert oder auch mit der Landwirtschaft synergistisch gekoppelt werden können, hat in Deutschland das Potenzial für ein Terawatt. Damit lässt sich sicherstellen, dass auch langfristig ausreichend Strom aus Sonnenenergie zu Verfügung steht.“
Brabec ist einer der weltweit führenden Entwickler organischer und gedruckter Fotovoltaik. Organische Solarzellen bestehen aus speziellen Polymeren und kohlenstoffbasierten Molekülen, zu denen Fullerene und weitere Kohlenstoff-Allotrope wie Nanoröhrchen oder Graphene zählen. Dieses Design ermöglicht es, die Module direkt auf flexible Folien zu drucken. In dieser Form können sie auch auf gewölbte Flächen, zum Beispiel Autodächer, geklebt werden. Der zweite entscheidende Vorteil: Die Module können in verschiedenen Farben, halbdurchlässig und sogar völlig transparent gefertigt werden. „Dadurch lassen sie sich gut in Gebäudefassaden integrieren“, erklärt Brabec. „Sogar Fensterscheiben werden zu Solarmodulen und tragen dazu bei, Häuser energieautark zu machen.“ Erste Studien bescheinigen der organischen Fotovoltaik eine hohe Umweltverträglichkeit und Rezyklierbarkeit.
Am Helmholtz-Institut für Erneuerbare Energien in Erlangen forscht Christoph Brabec aktuell daran, die organische Fotovoltaik noch effizienter und langlebiger zu machen: „Unser Ziel heißt 20/20. Die Module sollen einen Wirkungsgrad von 20 Prozent und eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren erreichen.“ Ein Schlüssel zum Erfolg liegt in der Entwicklung kombinierter Big-Data- und KI-Konzepte für automatisierte Forschungsanlagen.
Bioenergie: Enzyme statt Edelmetall

(Illustration: Roland Hallmeier)
Ein Fünftel des regenerativen Stroms in Deutschland wird aus Biomasse erzeugt, der Großteil davon in Biogasanlagen. Rechnet man die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr zusammen, gehen sogar über 50 Prozent grüner Energie auf das Konto von Biomaterialien. Allerdings enthält Biogas im Schnitt noch 30 Prozent Kohlendioxid, das für die Verbrennung keinen Nutzen hat. „Um den Anteil von Biomethan am Biogas zu erhöhen, wird Wasserstoff benötigt, der unter Energieaufwand mit dem CO2 zu Methan reagiert“, erklärt Katharina Herkendell vom Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik. „Dafür muss Wasser gespalten werden.“
Für das klassische zweistufige Verfahren von Wasser-Elektrolyse sowie anschließender Synthese von Kohlendioxid und Wasserstoff werden zumeist Katalysatoren aus Platin oder Iridium verwendet. Diese Edelmetalle sind erstens teuer und werden zweitens häufig unter fragwürdigen Bedingungen gewonnen. Herkendell forscht daran, die Metallkatalysatoren durch Biomaterialien zu ersetzen, zum Beispiel Enzyme, die mit Kohlenstoff-Nanostrukturen kombiniert werden. „Biokatalysatoren haben unschlagbare Vorteile“, sagt sie. „Sie sind erneuerbar, weitgehend unempfindlich gegenüber Verunreinigungen und funktionieren auch bei Raumtemperatur.“ So lassen sich Wasserspaltung und Methanproduktion mit Bioelektroden zu einem Schritt vereinen. Elektrisch vernetzte Enzyme arbeiten teilweise sogar so selektiv, dass in den Elektrosynthesezellen auf teure Protonenaustauschmembranen verzichtet werden kann.
Herkendell ist überzeugt davon, dass Bioelektrokatalysatoren noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts eine bedeutende Rolle bei der dezentralen Energieumwandlung spielen können. Für den Bereich Power-to-Gas/Liquid werden bereits heute Reaktoren getestet, bei denen Mikroben als Katalysatoren fungieren. Sie wandeln Wasserstoff und Kohlendioxid in Methan um, das direkt in das Gasnetz eingespeist werden kann. Zudem forscht die Nürnberger Bioingenieurin an vollständig erneuerbaren Brennstoffzellen mit Enzymkatalysatoren, die eine nachhaltige Stromerzeugung aus organischen Abfällen, Klärschlamm oder zellulosehaltiger Biomasse ermöglichen.

(Illustration: Roland Hallmeier)
Erdwärme: Hotspot Bayern
Erdwärme ist eine unerschöpfliche regenerative Energiequelle. Bislang wird sie vor allem in Regionen mit hoher vulkanischer Aktivität genutzt – etwa auf Island, wo heiße Quellen bereits oberflächennah angezapft werden können. Doch auch in Deutschland gibt es Gebiete mit enormem Potenzial – zum Beispiel das zwischen Donau und Alpen gelegene Molassebecken: „Wir finden hier ab etwa 4000 Metern Tiefe bis zu 140 Grad heiße Thermalwässer, die sich zum Teil sogar für die Stromproduktion eignen“, sagt Prof. Dr. Harald Stollhofen, Inhaber des Lehrstuhls für Geologie. Der Experte schätzt, dass die Metropolregion München künftig fast 70 Prozent ihres Wärmebedarfs durch Tiefengeothermie decken könnte.
Solche thermalwasserführenden Schichten gibt es in Nordbayern kaum. Doch auch hier könnte sich eine geothermische Erschließung lohnen: „In der Region zwischen Bamberg und Coburg haben wir unterhalb von etwa 2000 Meter Tiefe einen Granitkörper entdeckt, der von zahlreichen Verwerfungen und Brüchen durchzogen wird“, erklärt Stollhofen. „Diese natürlichen Brüche können mit heißem Wasser gefüllt sein, das über Bohrungen an die Oberfläche gepumpt werden kann.“ Die Fachleute sprechen bei diesem Verfahren von stimulierten geothermischen Systemen – im Gegensatz zu hydrothermischen im Falle des Molassebeckens.
Im Rahmen der Geothermie-Allianz Bayern (GAB) widmen sich die FAU-Geologen vor allem der Aufgabe, Karten und Modelle vom tieferen Untergrund des Freistaats zu erstellen. Stollhofen: „Solche Explorationsergebnisse gibt es bisher vorzugsweise in Gebieten, die bereits in der Vergangenheit für die Erdöl- und Erdgasförderung oder den Bergbau interessant waren. Aber in Nordbayern haben wir noch viele weiße Flecken auf dieser Karte.“ Weil allein eine Tiefbohrung mehrere Millionen Euro kostet und nur punktuelle Informationen liefert, nutzt das Team zunächst vor allem geophysikalische Methoden für die flächige Erkundung: seismische, gravimetrische und magnetische Verfahren etwa oder die isotopische Analyse austretender Gase. Stollhofen ist optimistisch: „Vielleicht kann Bayern eines Tages Geothermiestrom nach Norddeutschland liefern, wenn dort Windflaute herrscht.“
Leistungselektronik: hybride Netze und intelligente Wandler
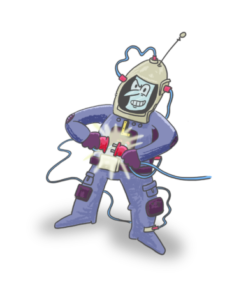
(Illustration: Roland Hallmeier)
Windkraftanlagen, Fotovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung – unser Energieversorgungssystem wird dezentraler und heterogener. Das führt dazu, dass die Zahl von Spannungs- und Frequenz-Umrichtungen dramatisch zunimmt. Zugleich fehlen durch den Wegfall der Großkraftwerke die Dirigenten im Netz, was zur Herausforderung für eine stabile Stromversorgung wird.
In Erlangen wird deshalb intensiv daran geforscht, welchen Beitrag die Leistungselektronik für die zunehmende Versorgung mit regenerativer Energie leisten kann. „Die unterschiedlichsten Erzeuger in ein Netz zu integrieren, wird eine gewaltige Aufgabe“, sagt Prof. Dr. Martin März, Inhaber des Lehrstuhls für Leistungselektronik. „Wir müssen es zum einen schaffen, die Wirkungsgrade von Wandlern, etwa von Wechselrichtern, zu maximieren. Zum anderen werden wir auch die Architektur der Netze überdenken müssen.“
Dazu zählt beispielsweise, unnötige Wandlungsvorgänge zu vermeiden. März: „Nehmen Sie die Fotovoltaik: Die Module auf dem Dach produzieren Gleichstrom, der noch vor Ort in Wechselstrom umgewandelt wird, weil das Hausnetz traditionell so ausgelegt ist. Für den Betrieb Ihres Laptops oder das Laden Ihres E-Autos muss aus dem Wechselstrom dann aber wieder Gleichstrom werden.“ März geht davon aus, dass hybride Netze mit separaten, in sich geschlossenen Gleichspannungsbereichen künftig zu deutlich kostengünstigeren und effizienteren Lösungen führen werden.
Für die Überwachung des Versorgungsnetzes wird sich die Leistungselektronik künftig auch Algorithmen der künstlichen Intelligenz bedienen, etwa um Schwankungen des Energieangebots blitzschnell ausgleichen zu können. Zugleich können Umrichter zu zentralen Elementen einer vorausschauenden Wartung werden. Sie wären in der Lage, Schäden an Erdkabeln zu registrieren und so zu helfen, Black-outs zu vermeiden. Aber auch der Blick in Richtung der elektrischen Verbraucher ist interessant: Anhand der Motorströme beispielsweise könnten Schäden an Antrieben frühzeitig erkannt werden, ohne dass dafür zusätzliche Sensoren installiert werden müssten.
Aus dem FAU-Forschungsmagazin friedrich, Ausgabe 121 (6.12.21)
Über den Autor
Matthias Münch studierte Soziologie und arbeitete als freier Journalist. Seit 2001 unterstützt er Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen bei der Öffentlichkeitsarbeit und Corporate Communication.
